Change Language :
Mobile Steckdose versorgt Containerschiffe am Hamburger Hafen schnell und flexibel mit Landstrom
Drei verfahrbare Energieketten am Kai sichern die punktgenaue Energiezufuhr für Schiffe.
Am Container Terminal Hamburg (CTH) wurden drei verfahrbare Landstromanschlüsse an den Kais installiert, die eine flexible, schnelle und sichere Stromanbindung von Containerschiffen gewährleisten. Auf 300, 150 und 110 m Länge richtet sich am CTH der Landstromanschluss punktgenau an der Anlegestelle der Schiffe aus. Beim Verfahren der mobilen "Steckdosen" helfen Rollen-Energieketten, die die schweren Leitungen sicher und kompakt führen. Das System senkt dadurch nicht nur die Betriebskosten und erhöht die Sicherheit. Es macht auch das Landstrom-Konzept als Gegenentwurf zum Betrieb umweltschädlicher Dieselgeneratoren zur Stromversorgung der angelegten Schiffe deutlich attraktiver.
Eingesetzte Produkte
Flexible Stromversorgung

Energieführung am Kai
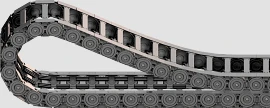
Energieführung am Panel

Motorleitungen

Zugentlastung

Sensorik für Kette/Leitung







